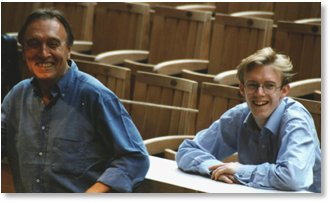
LUZERN UND DIE PRESSE
TAGES-ANZEIGER
28.August 2004
13. August
19.30 Uhr
Richard Strauss
Vier letzte Lieder
Renée Fleming
Richard Wagner
Tristan und Isolde
Akt.II
Violeta Urmana
John Treleaven
René Pape
Mihoko Fujimura
Peter Brechbühler
Ralf Lukas
Lucerne Festival Orchestra
CLAUDIO ABBADO
18 &19. August
19.30 Uhr
L.v. Beethoven
Klavierkonzert Nr 4 G-Dur op.58
Maurizio Pollini, Piano
Gustav Mahler
Sinfonie Nr. 5
Lucerne Festival orchestra
CLAUDIO ABBADO
23. August
19.30 Uhr
Paul Hindemith
Kammermusik Nr.5 op.36/4
Wolfram Christ, Viola
Kammermusik Nr.4 op.36/3
Kolja Blacher, Violin
"Finale 1921" aus Kammermusik Nr.1 op.24
L.v. Beethoven
Sinfonie Nr.1 C-Dur op.21
Solisten des Lucerne Festival Orchestra
Mahler Chamber Orchestra
CLAUDIO ABBADO
|
|
![]()
herum...
© Tages-Anzeiger; 28.08.2004; Seite 50
Kultur
LUCERNE FESTIVAL: WOCHENRÜCKBLICK (2)
Von gestern, heute und morgen
Zwischen Tradition und Moderne: Am Lucerne Festival gab es Widersprüchliches zu hören.
Von Patrick Müller
Es war ein Samstag nicht wie jeder andere - aber vielleicht einer, der in seiner Vielfalt typisch ist für ein Festival, das an allen Ecken und Enden Erweiterungen sucht, zugleich aber seinem Kerngeschäft, der Musik, mit Engagement treu bleibt. Am Vormittag also: Der moderne Interpretentyp mit einem Soloprogramm, das durchgestaltet ist bis in die kleinsten Verästelungen von Komposition und Konzeption. Am Nachmittag: Die Kinderoper mit Bezug zum Festivalthema «Freiheit» und vor einem wachen Publikum zwischen 7 und 77 Jahren. Am Abend: Das herkömmliche Orchesterkonzert mit einer Uraufführung und einem Klassiker des Repertoires. Ein Frühstück also mit dem Intellektuellen, für die Kinder das Anspruchsvolle, das Neueste im traditionellen Gefäss. Die Öffnung des Festivals hin zu einem Profil, das nahe sein will am Puls der Zeit, zugleich aber die ehrwürdige Tradition hochhält, führt durchaus zu Widersprüchlichem.
Barenboims veraltetes Beethovenbild
Die Widersprüchlichkeit zieht sich auch mitten durch jene Kunstform, die weiterhin ein Zentrum des Lucerne Festival ausmacht: die Interpretation. Pierre-Laurent Aimard, der sich am vergangenen Samstagvormittag in der Lukaskirche präsentierte, vertritt dabei jenen Interpretentyp, dem gewiss die Zukunft gehört. Bewandert ist er im klassischen Repertoire, und er hat dort etwas zu sagen: Debussys «Douze Etudes» interpretiert er mit traumwandlerischer Sicherheit, mit unerhörtem Reichtum an Gestaltung und Farbe, und er weiss auch dort noch deutlich und fasslich zu artikulieren, wo virtuose Pianistik Struktur und Komposition zu verschütten droht. Als moderner Interpret ist für Aimard auch konzeptuelles Denken selbstverständlich: Den zweiten Teil seines Rezitals komponierte er um die drei Stücke aus Birtwistles «Harrison's Clock» herum, und er fand - und zeigte - bei Werken von Ligeti, Bartók und Ravel, wie andere Komponisten mit musikalischen Themen umgehen, die auch Birtwistle beschäftigen: Puls, Zeit, Rhythmus. Das ausserordentlich spannende Hörangebot wurde vom Publikum dankbar aufgenommen, es strömte in Scharen, war begeistert.
Bleibt man bei den Pianisten, so ergab sich am Mittwochabend ein ganz anderes Bild: Daniel Barenboim versuchte sich an Beethovens Fünftem Klavierkonzert, leitete dabei von den Tasten aus die Staatskapelle Berlin. Es ist das Orchester, dem er seit über zehn Jahren als Chef vorsteht, und die Verblüffung mochte gross gewesen sein: Wie wenig es da eine gemeinsame Musizierhaltung gab, wie gross die Probleme in Koordination und Gestaltung waren, wie unflexibel Klang und Artikulation. Dass dies nicht nur an der ans Peinliche grenzenden pianistischen Überforderung Barenboims lag, zeigte auch die Interpretation von Beethovens Sechster Sinfonie im gleichen Konzert: In Umkehrung von Beethovens Untertitel war es mehr «Mahlerey» als «Ausdruck der Empfindung»: Mit breitestem Pinsel, fast durchgehend dick im Klang und mit kaum erkennbarer Zeichnung.
Insofern schien es konsequent, dass Barenboim für die konzertante Aufführung von Beethovens «Fidelio» am folgenden Tag Singstimmen wählte, die sämtliche wagnererfahren sind und somit als Einzige zumindest den Hauch einer Chance hatten, gegen den breiten und dicken Klang des Orchesters anzukommen. Zumal Waltraud Meier als Leonore und René Pape als Rocco beeindruckten mit dem natürlichen Volumen ihrer Stimmen. Doch vertritt Barenboim insgesamt ein Beethovenbild, das sich inzwischen vollkommen überlebt hat. Man braucht es nicht zu bedauern.
Bei Abbado öffnen sich Welten
Allerdings wäre es zu leicht, die Interpretentypen auf den beiden Seiten einer Trennlinie zwischen Tradition und Moderne einordnen zu wollen. Claudio Abbado etwa, der sich am Montag gemeinsam mit dem Mahler Chamber Orchestra ebenfalls mit Beethoven, hier seiner Ersten Sinfonie, auseinander setzte, ist durchaus ein traditioneller Interpret im emphatischen Sinne des Wortes, die äusserlichen Merkmale der historischen Aufführungspraxis scheinen ihn wenig zu interessieren. Und doch öffnen sich Welten, etwa in der Haltung gegenüber der Musik. Man mag ein oberflächliches Beispiel nehmen: Sowohl Barenboim wie Abbado lassen bisweilen die Zügel locker, setzen ihre dirigentischen Gesten für kurze Zeit aus. Bei ersterem führt dies nicht selten zu grossen Unsicherheiten im Orchester; bei Abbado hingegen machen die Musikerinnen und Musiker grosse Ohren, beginnen aufeinander zu hören, aufeinander zu reagieren, und es kommt zu einem Klang, der schlank ist, artikuliert, durchhörbar. Und wunderschön.
Vieles noch gäbe es zu berichten, so von den Auftritten des Cleveland Orchestras - eines der besten Klangkörper überhaupt -, darunter die erwähnte Birtwistle-Uraufführung am Samstag (TA vom 23. 8.), gefolgt von Schuberts grosser C-Dur-Sinfonie sowie, am nächsten Tag, von einer schönen Aufführung von Claude Debussys «Jeux» unter Leitung Franz Welser-Mösts. Begegnen konnte man - am Samstagnachmittag - schliesslich einer gelungenen Aufführung von Hans Krásas Oper für Kinder «Brundibár» durch die Mädchenkantorei Basel - und damit den Interpretinnen von morgen.
|
Letzte update
|
|
Der Wanderer |
|
Sich erinnern |
|
Schreiben Sie uns |